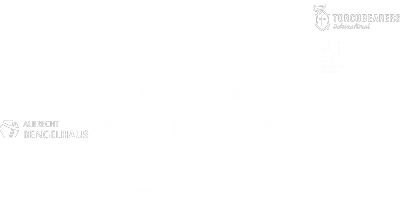Wie waren die letzten Tagen im Leben Jesus Christus?
Kurze Antwort
Die letzten Tage von Jesus Christus vor seinem Tod am Kreuz werden häufig als Passionszeit (Leidenszeit) bezeichnet. Christen weltweit denken in der Woche vor Ostern in Gottesdiensten und Andachten an diese Leidenszeit Jesu. Die Evangelien (Matthäus, Markus, Lukas und Johannes) erzählen von den letzten Tagen von Jesus Christus.
Die letzten Tage von Jesus Christus nach den synoptischen Evangelien
Die Evangelien von Matthäus, Markus und Lukas berichten alle von den letzten Tagen im Leben von Jesus Christus. Dabei ergänzen sie sich gegenseitig mit ihren Erzählungen.
a. Markusevangelium
In Markus 11,1-11 wird berichtet, wie Jesus in Jerusalem einzieht. Mit diesem Einzug beginnt die Passion Jesu. Jesus schickt zwei seiner Jünger voraus in die Stadt. Sie sollen ein Eselfohlen finden und zu ihm bringen. Auf diesem Eselfohlen reitet Jesus in die Stadt Jerusalem ein und erfüllt damit eine Vorhersage des Propheten Sacharja (Sacharja 9,9). Die Menschen jubeln Jesus zu und freuen sich.
Das Markusevangelium berichtet dann in seiner Passionserzählung in Markus 14,1-2 von dem Plan der Hohepriester und Ältesten, Jesus zu verurteilen und zu töten. Das geschieht aber nicht ohne das Wissen von Jesus selbst, der seinen Tod und seine Auferstehung vor seinen Jüngern bereits mehrfach vorausgesagt hatte (z. B. Markus 10,33-34).
Anschließend berichtet das Markusevangelium von der Salbung Jesu durch eine Frau mit Salböl (Markus 14,3ff). Jesus selbst deutet diese Salbung auf seine eigene Totensalbung hin, wie sie bei den Juden zur Zeit von Jesus üblich war.
Weiter erzählt das Markusevangelium vom Plan des Judas, Jesus an die führenden Priester zu verraten und ihn an seine Gegner auszuliefern. Es wird berichtet, dass Judas dafür Geld angeboten bekommt (Markus 14,10-11).
Dann folgt bei Markus der Bericht über das Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern (Markus 14,12ff). Dieses Abendmahl findet am ersten Tag der ungesäuerten Brote statt. Dabei handelt es sich um die Feier des Passamahls. Damit erinnert sich das Volk Israel an seine Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten durch Gott. Jesus ist zur Feier des Passafestes mit seinen Jüngern nach Jerusalem gekommen.
Er trägt seinen Jüngern auf, einen Raum für das gemeinsame Essen zu finden. Während des Essens kündigt Jesus den Verrat durch einen seiner Jünger an. Auch hier geschieht nichts ohne das Wissen von Jesus. Anschließend setzt Jesus das Abendmahl ein, das seine Nachfolger von nun an gemeinsam feiern sollen, um sich an seinen Tod und seine Auferstehung zu erinnern und mit ihm verbunden zu bleiben.
Nach dem gemeinsamen Essen geht Jesus in der Nacht mit seinen Jüngern zum Ölberg außerhalb der Stadt Jerusalem (Markus 14,26ff). Auf dem Weg kündigt er seinen Jüngern an, dass Petrus ihn noch diese Nacht, ehe der Hahn kräht, dreimal verleugnen wird.
Jesus begibt sich mit seinen Freunden in den Garten Gethsemane am Ölberg (Markus 14,32ff). Dort bittet er seine Jünger, wach zu bleiben und mit und für ihn zu beten. Er selbst betet etwas abseits seiner Jünger zu Gott. Dreimal findet er währenddessen seine Jünger schlafend vor. Markus berichtet, dass Jesus vor den nächsten Stunden seines Lebens große Angst hat, weil er schon weiß, dass der Tod am Kreuz auf ihn wartet.
Im Garten Gethsemane tauchen Männer mit Fackeln, Schwertern und Stangen auf, die von den Hohepriestern beauftragt waren. Sie verhaften Jesus (Markus 14,43ff). Judas identifiziert Jesus mit einem Kuss. Die Jünger von Jesus fliehen, weil sie große Angst haben.
Jesus wird noch in der Nacht vor den Hohenpriester und dann am Freitagmorgen vor den Hohen Rat geführt, um verhört zu werden (Markus 14,53ff). Zunächst gelingt es trotz Lügen und Intrigen nicht, ihn zu verurteilen. Als Jesus die Frage, ob er Messias und Sohn Gottes ist, bejaht, werfen die Anführer des Volkes ihm Blasphemie (Gotteslästerung) vor. Sie verspotten und schlagen Jesus.
Noch in der Nacht hatte sich Petrus in den Hof des Hohen Rates geschlichen und dort Jesus dreimal verleugnet, weil er Angst hatte, ebenfalls mit Jesus verurteilt zu werden (Markus 14,66ff). Als Petrus den Hahn krähen hört, realisiert er voller Schmerz seinen Verrat an Jesus.
Der Hohe Rat hatte nicht das Recht, eine Todesstrafe zu vollstrecken. Darum führt er Jesus vor den römischen Statthalter Pontius Pilatus (Markus 15,1ff*). Dieser findet zunächst keinen Grund dafür, Jesus zu verurteilen. Es wird von einer Tradition berichtet, nach der am Passafest ein Gefangener von Pilatus freigelassen wird. Doch das Volk, das von den Hohepriestern aufgewiegelt wurde, entscheidet sich gegen die Freilassung von Jesus. Markus berichtet, dass Pilatus sich beim Volk gut stellen will und Jesus deswegen zum Tod am Kreuz verurteilt (Markus 15,15).
Jesus wird zunächst verspottet, geschlagen und ausgepeitscht.
Dann führen Soldaten ihn hinaus zum Felsen Golgatha (übersetzt: Schädelplatz, vgl. Markus 15,22). Dort kreuzigen sie Jesus um die dritte Stunde (9 Uhr). Sie bringen ein Schild über seinem Kopf an, auf dem der Grund seiner Verurteilung steht: Jesus aus Nazareth, König der Juden (nach den lateinischen Anfangsbuchstaben abgekürzt INRI). Auch hier verspotten sie Jesus weiter. Markus berichtet, dass mitten am Tag von der sechsten bis zur neunten Stunde (12 Uhr bis 15 Uhr) eine große Finsternis aufkommt. Zur neunten Stunde betet Jesus laut Psalm 22: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Markus 15,34) und stirbt. Josef von Arimatäa bestattet Jesus in einem Felsengrab (Markus 15,42ff).
b. Matthäusevangelium
Die Berichte des Matthäusevangeliums entsprechen im Wesentlichen den Berichten des Markusevangeliums. An einigen Stellen vertieft der Autor noch Aspekte, trägt aber nichts wesentlich Neues bei. So berichtet er zum Beispiel davon, dass das Grab nach dem Tod von Jesus von Soldaten bewacht wurde (Matthäus 27,62ff).
c. Lukasevangelium
Auch das Lukasevangelium folgt im Wesentlichen dem Bericht der beiden anderen synoptischen Evangelien.
Einige ergänzende Perikopen berichten aber zum Beispiel von einer Begegnung zwischen Jesus und König Herodes Antipas (Lukas 23,6). Nachdem Jesus von Pontius Pilatus verhört wurde, lässt Pilatus Jesus zu Herodes bringen. Dieser ist zunächst neugierig, da er von den vielen Wundern gehört hatte, die Jesus getan hat. Auch vor Herodes beschuldigen die Schriftgelehrten Jesus schwer. König Herodes verspottet Jesus und schickt ihn zurück zu Pontius Pilatus.
Die letzten Tage von Jesus Christus nach dem Johannesevangelium
Das Johannesevangelium setzt beim Bericht über die letzten Tage von Jesus theologisch etwas andere Schwerpunkte. Das wird vor allem in der chronologischen Abfolge der Geschehnisse deutlich.
Auch Johannes berichtet von der Salbung Jesu durch eine Frau in Bethanien (Johannes 12,1ff). Erst anschließend zieht Jesus auf dem Esel nach Jerusalem ein und die Volksmenge jubelt ihm zu (Johannes 12,12ff). Johannes berichtet als Einziger der Evangelisten davon, dass Jesus vor Beginn des Passafests beim letzten Mahl mit seinen Jüngern diesen die Füße wäscht.
Der Passionsbericht des Johannesevangeliums wird immer wieder unterbrochen durch Reden von Jesus. Er spricht über seinen Tod, über sein Verhältnis zu seinem Vater im Himmel, betet für seine Jünger und verheißt ihnen den Heiligen Geist (Johannes 14–17).
In Johannes Kapitel 18 wird dann davon berichtet, wie Jesus gefangen genommen und von den Hohepriestern und Pontius Pilatus verhört wird.
Jesus wird verspottet, geschlagen und verurteilt, stirbt am Kreuz und wird begraben. Es fällt aber auf, dass Jesus nach dem Johannesevangelium zur gleichen Zeit stirbt, in der die Lämmer für das Passafest im Tempel geschlachtet werden. Dem Verfasser des Evangeliums ist wichtig: Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt (Johannes 1,29). An Jesus erfüllt sich dann auch, was im Alten Testament hinsichtlich des Passalamms geboten ist: Nach seinem Tod werden seine Beine nicht gebrochen, genauso wie es in 2. Mose 12,46 für das Passalamm bestimmt ist. Jesus stirbt als das Passalamm, das den Menschen ein für alle Mal die Versöhnung mit Gott bringt.
Der älteste Bericht von Jesu Tod und Auferstehung: 1. Korinther 15
Wissenschaftler vermuten, dass eines der ältesten schriftlichen Zeugnisse über die letzten Tage Jesu, seinen Tod und seine Auferstehung in 1. Korinther 15 zu finden ist. Es handelt sich vermutlich um ein Bekenntnis der ersten Christen. Schon hier wird bereits deutlich vor der Abfassung der Evangelien von Jesu Leiden, Tod und Auferstehung berichtet. Die Evangelien berichten dann später, was bis dahin mündlich weitergegeben wurde.
Katharina Sophia Trostel
Evangelische Landeskirche Württemberg
Meist gelesene Antworten
Who's behind?
Wer steckt hinter creedle rockc?