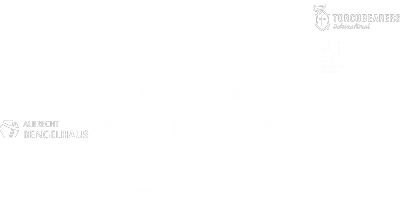Warum beten manche zu Jesus und Maria und nicht direkt zu Gott?
Kurze Antwort
Gebet und Anbetung sind ausschließlich an Gott zu richten. Da Jesus Gott ist, kann man zu ihm, wie auch zum Heiligen Geist beten. Der christliche Gott wird als ein Gott in drei Personen geglaubt. Die drei Personen sind Vater, Sohn (Jesus) und Heiliger Geist. Genau genommen ist die Anrufung Mariens kein Gebet, sondern eine Bitte um das Gebet. Es gibt christliche Konfessionen, in denen die Anrufung von Maria und auch anderer Personen, den sogenannten „Heiligen“, mit der Bitte um Gebet üblich ist.
Jesus empfängt als Gott Anbetung
Im biblischen Verständnis kommt Gebet und Anbetung nur Gott zu. Nach christlichem Verständnis trat Jesus von Nazareth mit dem Anspruch auf, Gott zu sein. Für die Juden der damaligen Zeit war die Anerkennung der Gottheit von Jesus eine große Herausforderung. Dennoch gibt es schon im Neuen Testament Formen der Anbetung und des Gebets zu Jesus. Zwei Beispiele für Anbetung:
„Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder. Sie sagten: ‚Du bist wirklich der Sohn Gottes!‘“ (Matthäus 14,33). Das Niederwerfen ist ein deutlicher körperlicher Ausdruck der Anbetung. Wenn die Jünger Jesus nur als Mensch angesehen hätten, wäre diese Geste absolut unpassend.
„Dann sagte er“ (der auferstandene Jesus) „zu Thomas: ‚Leg deinen Finger hierher und sieh meine Hände an. Streck deine Hand aus und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht länger ungläubig, sondern komm zum Glauben!‘ Thomas antwortete: ‚Mein Herr und mein Gott!‘“ (Johannes 20,27-28) Mit dieser Aussage bestätigte Thomas, dass er die Gottheit von Jesus anerkannte.
Ein Beispiel für Gebet als Bitte an Jesus: Paulus schrieb an die Korinther: „Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet, dass er ihn wegnimmt.“ (2.Korinther 12,8) Mit „Herr“ meinte Paulus Jesus.
Christliches Gebet ist an den einen Gott gerichtet, der als dreifaltiger Gott, in Vater, Sohn (Jesus) und Heiligem Geist geglaubt wird. Wer also zu Jesus betet, betet zu Gott, nicht zu einem Menschen. Anders verhält es sich mit Maria.
Ansprache / Anrufung Marias ist kein Gebet
Auch wenn umgangssprachlich von Gebet an bzw. zu Maria gesprochen wird, ist es genau genommen kein Gebet. Es ist eine Anrufung / Ansprache mit der Bitte um Fürbitte-Gebet. Als Beispiel sei hier das sogenannte „Ave Maria“ zitiert: „Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.“
Die Anrufung setzt sich aus zwei Bibelzitaten zusammen, wobei im ersten Zitat der Name Maria und im zweiten der Name Jesus ergänzt wird. Das erste stammt aus der Anrede des Engels an Maria, als ihr die Schwangerschaft angekündigt wird: „Sei gegrüßt! Gott hat dir seine Gnade geschenkt. Der Herr ist mit dir.“ (Lukas 1,28) Und das zweite aus Lukas 1,42, aus dem Ausruf Elisabeths, als Maria sie besucht: „Gesegnet bist du unter allen Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Bauch!“ „Gebenedeit“ ist ein altertümlicher Ausdruck für „gesegnet“, der vom lateinischen Wort „benedicere“ (segnen) stammt. Am Ende der Anrufung wird das Anliegen formuliert, dass Maria jetzt und in der Todesstunde für uns bitten soll. Es handelt sich also um eine Aufforderung zu einer Fürbitte, die von Maria an Gott gerichtet werden soll. Vor allem in der katholischen und orthodoxen Tradition des Christentums gibt es vielfältige weitere Anrufungen an sogenannte Heilige.
Warum nicht direkt zu Gott beten?
Wir lesen in der Bibel, dass der Apostel Paulus in seinen Briefen an verschiedenen Stellen um Gebet für sich bittet. „Betet auch für mich, dass Gott mir die richtigen Worte in den Mund legt. Dann kann ich offen und unverhüllt das Geheimnis der Guten Nachricht bekannt machen. Auch in Ketten bin ich ein Botschafter für sie. Betet also dafür, dass ich die Gute Nachricht offen und unverhüllt verkünden kann – so wie mein Verkündigungsauftrag es erfordert.“ (Epheser 6,19-20) Für Paulus war es anscheinend kein Problem, zusätzlich zum direkten Gebet an Gott auch das Fürbittgebet seiner Glaubensgenossen zu erbitten. Weitere Stellen, in denen er das tut, finden wir in Römer 15,30; 2.Korinther 1,11; 1.Thessalonicher 5,25; 2.Thessalonicher 3,1-2.
Eine Bitte um Fürbitte bei anderen Gläubigen ist biblisch gesehen also in Ordnung. Auch wenn die Frage offen bleibt, warum diese Bitte ausgesprochen wird. Um aber die Praxis der Anrufung von Verstorbenen verstehen zu können, braucht es zwei Voraussetzungen. Zum einen die Vorstellung, dass ein verstorbener Christ nicht gänzlich tot ist. Zum anderen, dass er ansprechbar und in Bezug auf Gott sprachfähig ist. In den christlichen Kirchen haben sich zu diesem Fragenkreis unterschiedliche Glaubensvorstellungen entwickelt. Um uns diesen anzunähern, schauen wir uns biblische Aussagen zu dem Thema an.
Sicht vom Leben nach dem Tod
Im Alten Testament wird von einem Aufenthaltsort der Toten geredet, auf hebräisch Scheol. In den älteren Schriften scheint diese Vorstellung noch wenig differenziert. Dieser Ort ist ein Sammelplatz, an dem der Mensch keine Handlungsmöglichkeiten mehr hat; teils wird er als ein Ort ohne Wiederkehr beschrieben. Es gibt Andeutungen, dass dies der Ort des Versagens bzw. der Strafe ist, analog der Vorstellung der Hölle. „Ein Mensch, der den Weg der Vernunft verlässt, wird bald den Toten Gesellschaft leisten“ (Sprüche 21,16). Beim Propheten Daniel ist es ein Ort der Zwischenzeit, an dem die Toten schlafen; erst danach erfolgt die Belohnung bzw. Strafe. „Von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden viele vom Tod aufwachen – die einen zu ewigem Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande“ (Daniel 12,2).
Im geschichtlichen Buch Samuel wird eine Situation berichtet, die voraussetzt, dass die Toten nicht ganz tot sind. An dieser Stelle sucht der König Saul eine Totenbeschwörerin auf, die für ihn den Geist des verstorbenen Samuels herbeiruft. „Samuel sagte zu Saul: ‚Warum störst du mich in meiner Ruhe und lässt mich aus der Erde heraufsteigen?‘“ (1. Samuel 28,15) Diese Art, mit Toten in Kontakt zu treten, ist im Gesetz des damaligen Volkes Israel ausdrücklich verboten. „Auch darf niemand Beschwörungen sprechen, Vorfahren oder Geister befragen oder sich überhaupt an die Toten wenden. Denn der Herr verabscheut jeden, der so etwas tut.“ (5.Mose 18,11-12)
Es gibt im Alten Testament auch die Vorstellung des direkten Eingangs in die göttliche Gegenwart im Himmel: „Und wenn mein Leben zu Ende geht, nimmst du mich in deine Herrlichkeit auf. Wen habe ich denn im Himmel? Bei dir zu sein, ist alles, was ich mir auf der Erde wünsche. Auch wenn mein Leib und mein Leben vergehen, bleibst du, Gott, trotz allem mein Fels und mein Erbteil für immer! (Psalm 73,24-26) Aus der Lektüre des Alten Testaments erhalten wir kein klares Bild, wie es sich mit dem Menschen nach dem Tod verhält.
Das Neue Testament erzählt ein Gleichnis (Lukas 16,19-31), in dem die weitere Geschichte von zwei Gestorbenen beschrieben wird. Der arme Lazarus wird von Engeln in Abrahams Schoß getragen, der Reiche wird begraben und leidet in der Unterwelt qualvolle Schmerzen. Der Reiche kann Abraham und Lazarus über sich sehen und mit ihnen sprechen. Er bittet, Abraham möge Lazarus schicken. Dieser solle ihm mit seinem Finger und kaltem Wasser Linderung verschaffen. Abraham antwortet ihm, dass ein unüberwindlicher Abgrund die beiden Bereiche trennt und niemand von einem in den anderen gelangen kann. Außerdem soll sich der Reiche erinnern, dass er schon zu Lebzeiten seine Wohltaten erhalten habe, aber Lazarus nur Schlechtes. Es gibt also zwei Bereiche, einen der Qual und einen des Trostes. Inwieweit diese Geschichte Abrahams Schoß als Endzustand Himmel und die Unterwelt als Hölle versteht, bleibt deutungsoffen. Hauptaussage ist, dass man auf die Schrift (Mose und die Propheten) hören soll.
Im Johannesevangelium lesen wir in der Übersetzung der Basisbibel: „Amen, amen, das sage ich euch: Wer an meinem Wort festhält, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt.“ (Johannes 8,51) Im griechischen Urtext heißt es, dass derjenige den Tod nicht schauen wird. Daraus lesen manche, dass es für die Glaubenden keine zwischenzeitliche Nichtexistenz gibt und sie mit ihrem leiblichen Tod direkt bei Gott sind.
Paulus schreibt über seinen Wunsch bei Gott zu sein: „So sind wir in jeder Lage zuversichtlich. Wir sind uns zwar bewusst: Solange wir in unserem Körper wohnen, leben wir noch nicht beim Herrn. Unser Leben ist vom Glauben bestimmt, nicht vom Schauen dessen, was kommt. Trotzdem sind wir voller Zuversicht. Am liebsten würden wir unseren Körper verlassen und beim Herrn leben.“ (2.Korinther 5,6-8) Es bleibt offen, wie er sich dieses „beim Herrn leben“ vorstellt, ob es körperlos oder mit neuem Körper ist.
In der Offenbarung des Johannes wird eine Szene beschrieben, in der die „Seelen“ der Märtyrer sich zu Wort melden: „Als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich einen Altar und darunter Seelen. Es waren die Seelen der Menschen, die hingeschlachtet wurden, weil sie an das Wort Gottes glaubten – und weil sie als Zeugen dafür eingetreten sind. Sie riefen mit lauter Stimme: ‚Wie lange dauert es noch, du heiliger und wahrhaftiger Herrscher? Wann sprichst du das Urteil? Wann ziehst du die Bewohner der Erde zur Rechenschaft, weil sie unser Blut vergossen haben?‘ Jede einzelne Seele erhielt ein weißes Gewand.“ (Offenbarung 6,9ff) In dieser Vision werden Seelen beschrieben, die vor der allgemeinen Auferstehung schon in Gottes Gegenwart sind und als sprachfähig wahrgenommen werden. Dass jede Seele ein weißes Gewand bekommt, übersteigt wohl unsere Vorstellungskraft.
Die Bibel gibt also verschiedene Hinweise, aber keine klare Beschreibung, was mit dem Menschen nach dem leiblichen Tod passiert. Die christlichen Konfessionen haben daher verschiedene Vorstellungen zu diesem Fragenkreis entwickelt. Manche betrachten die Seele als unsterblich, sodass diese nach dem Tod des Leibes weiter existiert. Andere gehen davon aus, dass die Seele mit einem Zwischenleib für die Zeit im Himmel bis zur Auferstehung versehen wird. Bei wiederum anderen gibt es keine „Zwischenexistenz“ vor der Auferstehung aller Toten (am Ende der Welt).
Anrufung von Heiligen
Einige christliche Kirchen haben das Verständnis, dass die Verstorbenen nicht ganz tot sind und die Seelen der Gläubigen schon bei Gott sind. Davon ausgehend haben sie eine Sicht der Kirche als Leib Christi, die über die Todesgrenze hinausgeht. In ihrem Verständnis bilden die aktuell lebenden Menschen in der Kirche die sogenannte „pilgernde Kirche“. Die Gläubigen, die nach ihrem Tod in irgendeiner Weise schon bei Gott sind, werden „glorifizierte Kirche“ genannt. In diesem Verständnis ist die Bitte um Gebet an einen Gläubigen, der bereits bei Gott ist, für diese christliche Konfessionen nachvollziehbar.
Entsprechend empfiehlt die Katholische Kirche ihren Gläubigen die Bitte an die sogenannten „Heiligen“ um Gebet: „Wir können und sollen sie (die Heiligen) bitten, für uns und für die ganze Welt einzutreten.“ (Katechismus der Katholischen Kirche Nr. 2683) „Die pilgernde Kirche ist in ihrem Beten mit dem Gebet der Heiligen verbunden, deren Fürsprache sie erbittet.“ (Katechismus der Katholischen Kirche Nr. 2692) Der Titel „Heiliger“ wird einem Christen posthum verliehen, der von der römisch-katholischen Kirche offiziell heiliggesprochen wird. In der römisch-katholischen Kirche wird der Prozess der Heiligsprechung zentral geregelt. In den Orthodoxen Kirchen ist jede Teilkirche selbst dafür verantwortlich.
Andere christliche Konfessionen, insbesondere im Protestantismus, sehen die Möglichkeit der Bitte um Fürbitte an einen verstorbenen und somit verherrlichten Gläubigen nicht gegeben. In protestantischen Kirchen werden alle Christen als Heilige gemäß ihrer Stellung durch den Glauben an Jesus Christus betrachtet (1.Korinther 1,2). Deshalb ist es ihrer Überzeugung nach nicht Sache der Kirche, einzelne Personen hervorzuheben. Die Anrufung von verstorbenen Gläubigen ist für sie nicht mit der Bibel vereinbar und sie teilen die hier dargelegten Argumente nicht. Am Gebet der Christen füreinander wird festgehalten, aber nur diesseits der Todesgrenze.
Für katholische und orthodoxe Christen ist die Praxis der Anrufung der Heiligen kein Akt, der die Größe Gottes mindert. Sie sehen diese Art der Frömmigkeit nicht im Widerspruch zum biblischen Zeugnis.
Roland Abt
Meist gelesene Antworten
Who's behind?
Wer steckt hinter creedle rockc?