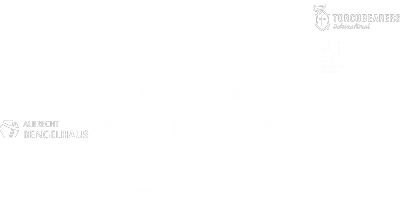Ist Jesus Christus der Messias?
Kurze Antwort
„Christus“ wird weitgehend als zweiter Eigenname von Jesus verstanden, ist aber eigentlich ein Bekenntnis. Denn das griechische Wort „christos“ ist die Übersetzung des hebräischen Begriffs „Messias“. Wer also Jesus den Christus nennt, sagt aus, dass er der im Alten Testament erwartete Messias ist. Deshalb wurden die Schüler und Nachfolger von Jesus schon bald „Christen“ genannt, d. h. Messias-Gläubige. Die Kritiker von Jesus allerdings lehnten diesen Anspruch von Anfang an ab.
Ursprünge der Messiaserwartungen
Die Vorstellung von einem Messias (wörtlich: einem Gesalbten) wurzelt tief im Alten Testament. Gesalbt wurden Personen, die von Gott für eine besondere Aufgabe ausgewählt und dafür mit Gottes Geist begabt worden waren. Es waren Propheten, Priester und Könige wie z.B. Mose oder David. Aus ihrem Beispiel und in der Gewissheit, dass Gott mit seiner Weltgeschichte ans Ziel kommen wird, erwuchs im Judentum die Erwartung eines Gesalbten. Dieser würde endgültig für Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit sorgen, gesandt von Gott und mit seinem Geist begabt. Schon zu König Davids Zeiten wurde diese Erwartung ausgesprochen (2. Samuel 7,12f). Der Prophet Jesaja wiederholte dies Versprechen über 200 Jahre später mehrfach (Jesaja 9,5f, Jesaja 11,1f). Darüber hinaus gibt es in der Gesamtheit der Prophetenbücher und in den Psalmen zahlreiche weitere Beschreibungen des Messias und seiner Zeit. Sie erzählen von den Wundern, die er tut, von einer friedvollen Welt, von seinem Sieg über die Feinde des Volkes Gottes und ein gerechtes Gericht.
Messiaserwartungen zur Zeit von Jesus
Die Erwartung eines messianischen Reiches überdauerte im Judentum auch die Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Als Jesus in Betlehem geboren wurde, hatte sich die Erwartung der meisten allerdings auf einen Herrscher konzentriert, der den Menschen in Juda die politische Freiheit bringen würde. Entsprechend enttäuscht waren sie, dass Jesus, von dem manche sagten, er sei der Messias, ganz unpolitisch handelte. Bei seinem triumphalen Einzug in Jerusalem etwa ritt er auf einem Esel, wie über den Messias vorausgesagt. Doch er zog nicht zum Palast des römischen Statthalters, sondern in den Tempel (Markus 11,1-10, Sacharja 9,9f). Entsprechend umstritten war in der Folgezeit das Bekenntnis zu Jesus als Messias. Er heilte Menschen und tat Wunder, aber es herrschte nach wie vor kein Friede (Matthäus 11,2-6).
Die Frage der Erfüllung der Messiaserwartungen
Ist Jesus nun der Christus, also der Messias? Jesus selbst hat sich so verstanden. Er hielt diese Überzeugung zwar zurück, weil er die Menschen zu einer eigenen Entscheidung bringen wollte (Matthäus 16,16). Aber in zahllosen Zusammenhängen unterstrich er, dass sein Leben, sein Tod und seine Auferstehung längst in den alten Schriften beschrieben sind (Lukas 18,31, Lukas 22,37). Oft bezeichnete er sich dann als Menschensohn, ein weiterer Name für den Messias, die aus dem Buch Daniel stammt (Daniel 7,13f).
Die Freunde und Schüler von Jesus haben in ihm den Verheißenen erkannt. Die Parallelität von alttestamentlichen Vorhersagen und dem Leben von Jesus haben sie überzeugt (Apostelgeschichte 2,36). Sie haben anerkannt, dass Jesus zwar keinen politischen Auftrag hatte, aber eine andere Freiheit brachte: die Freiheit von Schuld und die Versöhnung mit Gott. Sie haben mit dieser Überzeugung den Grundstein des christlichen Glaubens gelegt. Dass Jesus eines Tages wiederkommt und seine Aufgabe umfassend zu Ende führt, diese Erwartung gehört mit zum Bekenntnis, dass Jesus Christus der Messias ist.
Maike Sachs Pfarrerin und Studienleiterin am Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen (www.bengelhaus.de)
Meist gelesene Antworten
Who's behind?
Wer steckt hinter creedle rockc?